Reportage aus dem Ruhrgebiet
Ein Erbe mit Hypothek

REPORTAGE. Kohleabbau, einst der ganze Stolz des Ruhrgebiets, hinterließ „Ewigkeitskosten“ und eine zerstörte Umwelt. Wie man aus der Not eine Tugend machte und ehemalige, teils kontaminierte Industrieflächen zu einem Landschaftspark, Kulturzentren, Museen oder Sportstätten umfunktionierte.
Von David Knes

Sonne und Regen wechseln gefühlt minütlich, ein typischer Apriltag. „Das Piepen, das Sie hören, das ist nicht die historische Situation“, freut sich der pensionierte Landschaftsplaner Michael Schwarze-Rodrian, als die Vögel gerade besonders laut zwitschern. Wir spazieren durch einen kleinen Birkenwald, entlang an zugewachsenen Bahngleisen der „Zeche Zollverein“ in Essen.
In einer Serie von Reportagen vor der EU-Wahl leuchten wir Themen aus, die für die Zukunft Europas entscheidend werden. In diesem Teil geht es nach Deutschland und um die Frage, wie Renaturierung gelingen kann.
Deutschland ist mit 84,4 Millionen Menschen das einwohnerreichste Land der EU und zugleich jenes mit der größten Wirtschaftsleistung.
Das Ruhrgebiet (knapp 4440 Quadratkilometer) gehört zu den kleineren deutschen Regionen, zählt mit 5,1 Millionen Einwohnern aber zu den größten Ballungsräumen Europas. Die Region im Bundesland Nordrhein-Westfalen mit dem namensgebenden Fluss Ruhr im Süden besteht aus insgesamt 53 Städten.
Darunter auch die knapp 600.000 Einwohner zählende Stadt Essen, die wie das gesamte Gebiet über Jahrhunderte von der Montanindustrie geprägt wurde. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann ein jahrzehntelanger Strukturwandel, die Region verlor fast die gesamte Schwerindustrie, die enorme Umweltschäden zurückließ, während andere Wirtschaftssektoren lange unterentwickelt waren.
Genau davon zeugt hier die „Zeche Zollverein“, das einst größte und modernste Steinkohlebergwerk der Welt. Von 1847 bis zur Schließung 1986 arbeiteten dort insgesamt mehr als 600.000 Menschen.
In einer Serie von Reportagen vor der EU-Wahl leuchten wir Themen aus, die für die Zukunft Europas entscheidend werden. In diesem Teil geht es nach Deutschland und um die Frage, wie Renaturierung gelingen kann.
Deutschland ist mit 84,4 Millionen Menschen das einwohnerreichste Land der EU und zugleich jenes mit der größten Wirtschaftsleistung.
Das Ruhrgebiet (knapp 4440 Quadratkilometer) gehört zu den kleineren deutschen Regionen, zählt mit 5,1 Millionen Einwohnern aber zu den größten Ballungsräumen Europas. Die Region im Bundesland Nordrhein-Westfalen mit dem namensgebenden Fluss Ruhr im Süden besteht aus insgesamt 53 Städten.
Darunter auch die knapp 600.000 Einwohner zählende Stadt Essen, die wie das gesamte Gebiet über Jahrhunderte von der Montanindustrie geprägt wurde. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann ein jahrzehntelanger Strukturwandel, die Region verlor fast die gesamte Schwerindustrie, die enorme Umweltschäden zurückließ, während andere Wirtschaftssektoren lange unterentwickelt waren.
Genau davon zeugt hier die „Zeche Zollverein“, das einst größte und modernste Steinkohlebergwerk der Welt. Von 1847 bis zur Schließung 1986 arbeiteten dort insgesamt mehr als 600.000 Menschen.
Der Ort steht symbolhaft für die Identität des Ruhrgebiets als stolzer Industrie-Vorreiter. Ein Wirtschaftsmotor, der – befeuert durch die enormen Kohlevorkommen – Innovation und Wohlstand brachte. Längst ausrangierte Kohlewagen, die Gärten am Stadtrand zieren, zeigen, dass sich die Menschen ihres Erbes bewusst sind.
Es ist ein Erbe mit Hypothek: „Ewigkeitskosten“. Das Nachrutschen von Erdschichten aufgrund der beim Abbau in mehr als 1000 Metern Tiefe entstandenen Hohlräume ließen die Oberfläche vielerorts um bis zu 25 Meter absinken.
Große Teile des Ruhrgebiets wären deswegen heute eine Seenlandschaft, gäbe es nicht Hunderte ständig laufende Pumpen. Zudem darf sich mit Schadstoffen und Salz belastetes Grubenwasser in der Tiefe nicht mit dem oberflächennahen Grundwasser vermischen. Pumpen in mehreren Hundert Metern Tiefe verhindern deswegen einen Anstieg des Grubenwassers.

Die renaturierte Emscher in Dortmund
Die renaturierte Emscher in Dortmund
Heute ist die alte Zeche mit der Kokerei und dem Park nicht nur Industriedenkmal und Unesco-Weltkulturerbe, sondern auch Teil des städteübergreifenden „Emscher Landschaftsparks“. Das Konzept entstand bei der von 1989 bis 1999 dauernden Internationalen Bauausstellung (IBA) unter der Leitung von Karl Ganser: 450 Quadratkilometer teils kontaminierter Industrieflächen wurden saniert und der Bevölkerung zugänglich gemacht.
Sie betten eindrucksvolle alte Industriebauten in Grünraum – „Industrienatur“ – ein. Viele der dem Verfall geweihten Monumente wurden zu Kulturzentren, Veranstaltungshallen, Museen oder Sportstätten umfunktioniert. Andere holt sich die Natur zurück. Hunderte Kilometer stillgelegter Gleise und Kanäle dienen heute als Radwegnetz, das die Standorte des Parks ohne Umwege und vom Autoverkehr getrennt miteinander verbindet.
Die Idee des Emscher Landschaftsparks hätte von der Realität damals weiter nicht entfernt sein können. Der namensgebende Fluss war „so stark verunreinigt, dass Menschen mit Stacheldrähten von dessen Ufern ferngehalten werden mussten, er war zu giftig.“
Zum weltweiten Vorbild als Landschaftspark war es ein weiter Weg, den Michael Schwarze-Rodrian in seiner Funktion bei der IBA von vielen Steinen befreien musste. Ende der 1980er-Jahre war das Ruhrgebiet durch den gnadenlosen Strukturwandel ökonomisch und ökologisch am Ende, der scheinbar ausweglose Abstieg hatte sich auch in den Köpfen festgesetzt, wie der junge Akademiker aus Berlin im lang ersehnten praktischen Einsatz damals schnell feststellen musste.

Michael Schwarze-Rodrian vor den alten Hochöfen der Kokerei im Zollverein
Michael Schwarze-Rodrian vor den alten Hochöfen der Kokerei im Zollverein
Was hier geschah, war nicht nur ein Umweltverbrechen, sondern auch ein soziales.
Gemeinsam mit seinem Team hatte Schwarze-Rodrian 5000 Hektar potenziell geeignete Brachflächen ausfindig gemacht, Hunderte Kilometer stillgelegter Gleise und Bergehalden gefunden, um daraus Ideen zur Umgestaltung zu entwickeln. Doch die 17 Städte, die es zu überzeugen galt, teilten die Begeisterung nicht: „Die Entscheidungsträger sagten: ‚So ein Blödsinn, hier ist keine Landschaft, hier ist keine Schönheit, hier ist hässlich, hier wird gearbeitet, das ist halt so.‘ Wir waren völlig frustriert.“ Er hat auch eine Erklärung für die Ablehnung parat: „Innovation tut weh, sie stresst das Etablierte.“


Aber Ganser glaubte an das Vorhaben und inspirierte auch Schwarze-Rodrian. So stresste man das Etablierte jahrelang. Mit geschickter Kommunikation und Hartnäckigkeit kam die Idee Landschaftspark an, und bis 1999 sollten mehr als 100 Projekte umgesetzt werden. Von Vorteil war, dass dem damaligen Landeschef von Nordrhein-Westfalen und späteren Bundespräsidenten Johannes Rau (SPD) Umweltschutz ein Anliegen war.
Innovation tut weh, sie stresst das Etablierte.
Man legte Wert darauf, dass die Beteiligten miteinander arbeiten. Nachbarstädte entwickelten gemeinsam die Landschaft zwischen ihnen. Ortskenntnis war dabei obligatorisch. „Ganser hat die eine oder andere Besprechung abgebrochen, wenn sich herausstellte, dass mehrere der Anwesenden einen Ort nicht selbst kannten. Die hatten dann ein paar Tage Zeit, um das nachzuholen, bevor weitergeredet wurde“, erzählt Michael Schwarze-Rodrian.
Duisburg. Hier, nahe der Mündung der 83 Kilometer langen Emscher in den Rhein, befindet sich der Landschaftspark Duisburg-Nord samt der imposanten alten Hochofenkulisse, die nicht nur ein beliebtes Fotomotiv ist. Das 180-Hektar-Areal beheimatet auch 700 Pflanzenarten – mehr als ein Drittel aller in NRW vorkommenden Arten. Am Gelände befinden sich auch Sportstätten. So wurde etwa der Gasometer zum Tauchturm umgebaut. Sportler und Einsatzkräfte können nun hier im größten Becken dieser Art Europas unter realistischen Bedingungen trainieren, etwa an alten Autowracks.

Das Areal des alten Stahlwerks im Dortmunder Stadtteil Hörde im Jahr 2002
Das Areal des alten Stahlwerks im Dortmunder Stadtteil Hörde im Jahr 2002
„Wir reden ja eigentlich nicht so gut von unserer Stadt“, erzählt der Kellner in einer Kneipe in Duisburg, „hier ist es eigentlich nicht so prickelnd, aber das mit dem Park, das war schon was. Der wurde sogar zu einem der besten Stadtparks der Welt gewählt!“ Dass der „Guardian“ den 180-Hektar-Park rund um das stillgelegte Hüttenwerk einmal zu den zehn besten der Welt gezählt hat, weiß man hier. Und anscheinend auch anderswo: Mit rund einer Million Besucher pro Jahr ist der Park ein Wirtschaftsfaktor. Neben Deutsch ist Niederländisch am häufigsten zu hören.
Eine Flusssanierung als Milliardenprojekt

Für alle größeren Umgestaltungen gab es Wettbewerbe, oft gewannen namhafte Künstler und Architekten. Peter Latz plante etwa die Eingriffe und bewussten Nicht-Eingriffe in Duisburg. Der kürzlich verstorbene Bildhauer Richard Serra schuf in Essen eine der bekanntesten Landmarken des Ruhrgebiets. Schwarze-Rodrian ist überzeugt, dass der Park so nicht funktioniert hätte, wenn man sich mit weniger als dem Besten zufriedengegeben hätte, wie er auf einer von Jörg Schlaich entworfenen Brücke in Bochum erklärt, die sich spektakulär an Baumwipfeln vorbeischlängelt, über eine Straße und Bahntrassen hinweg. Sie verbindet den Westpark mit dem restlichen Radwegnetz.
All das hat seinen Preis. Von 1989 bis 1999 beliefen sich die Kosten der IBA-Projekte auf etwa fünf Milliarden Deutsche Mark, also rund 2,5 Milliarden Euro. Eine Milliarde wurde privat finanziert (darunter zum Beispiel die Renovierung von Arbeiterwohnungen), 1,5 Milliarden kamen von der öffentlichen Hand – von der Bundesrepublik ebenso wie von NRW, von den Kommunen selbst und aus EU-Fördertöpfen.
Aber was wurde aus der giftigen Emscher? Der Fluss war gegen Ende des 19. Jahrhunderts tot. Immer wieder litt die Region deswegen unter Cholera- oder Typhus-Ausbrüchen.
„Köttelbecke“ wurde zum Synonym, brachte der Fluss doch 100 Jahre einen erbärmlichen Fäkalgestank in die Städte und Dörfer. In Betonrinnen gezwängt und begradigt, verlor die Emscher sämtliche ökologischen Funktionen, auch der natürliche Hochwasserschutz ging verloren. „Das war nicht nur ein Umweltverbrechen, sondern auch ein soziales“, fasst Schwarze-Rodrian die Sünden der Vergangenheit zusammen.
In den 1980ern wurde die Idee zur Sanierung des Flusses immer populärer, 1991 fiel der Entschluss zur Renaturierung des gesamten Emscher-Systems. Damit griff man der 2000 in Kraft getretenen EU-Gewässerschutzrichtlinie vor, mit der ein „guter Zustand“ von Europas Gewässern bis 2015 gesetzlich verankert wurde. Die noch weiter gehende Renaturierungsrichtline, nach der bis 2050 alle sanierungsbedürftigen Ökosysteme wiederhergestellt werden sollten, ist nach langen Debatten (mit viel Widerspruch aus Österreich) vergangenen März im Rat gescheitert – obwohl fertig ausverhandelt.
Neue Kläranlagen, kilometerlange Abwasserkanäle, das Anlegen von Auenflächen und zahllose andere Maßnahmen waren für die Rettung der Emscher nötig. Drei Jahrzehnte und fünf Milliarden Euro später jubelten die Zeitungen Anfang 2022: Die Emscher ist komplett abwasserfrei. Dennoch wird es weitere Jahre bis Jahrzehnte dauern, bis sich die Flusslandschaft völlig erholt hat und ihre ursprüngliche Qualität erreicht.
Als die IBA 1999 zu Ende ging, war der Landschaftspark fest etabliert und politisch unumstritten. Die Projekte dienten als Blaupause für weitere Vorhaben. Eines der spektakulärsten findet sich im Stadtteil Hörde in Dortmund. Auf den ersten Blick erinnert wenig an die Stahl- und Kohle-Vergangenheit. Dabei befand sich hier vor ein paar Jahren noch das 98 Hektar große Areal eines stillgelegten Stahlwerks. Für 15 Millionen Euro kaufte die Stadt das Gelände von Thyssen Krupp ab, trug es ab und begann 2006 zu graben, um einen See entstehen zu lassen. Im Mai 2011 wurde der Uferbereich für die Bevölkerung freigegeben. Heute ist der Phönix-See mit dem umliegenden Park beliebtes Ausflugsziel.


Rentnerin Angelika Schlöter
Rentnerin Angelika Schlöter
Am Ufer treffen wir Angelika Schlöter. Die Rentnerin wohnt seit 50 Jahren in einem Dortmunder Vorort. Den Begriff „Emscher Landschaftspark“ kennt sie, anders als der Kellner in Duisburg, nicht, verwendet zufällig aber die gleichen Worte, um Hörde vor der Umgestaltung zu beschreiben: „Nicht so prickelnd.“ Jetzt aber komme sie jeden zweiten Tag hierher: „Der See, die Vögel, die Menschen“, sie findet es einfach schön hier. Bevor sie weiterschlendert, zu einem der Cafés am Ufer, berichtet sie noch stolz, dass sie in der Region schon 10.000 Kilometer mit dem E-Bike zurückgelegt hat.
Am Ufer treffen wir Angelika Schlöter. Die Rentnerin wohnt seit 50 Jahren in einem Dortmunder Vorort. Den Begriff „Emscher Landschaftspark“ kennt sie, anders als der Kellner in Duisburg, nicht, verwendet zufällig aber die gleichen Worte, um Hörde vor der Umgestaltung zu beschreiben: „Nicht so prickelnd.“ Jetzt aber komme sie jeden zweiten Tag hierher: „Der See, die Vögel, die Menschen“, sie findet es einfach schön hier. Bevor sie weiterschlendert, zu einem der Cafés am Ufer, berichtet sie noch stolz, dass sie in der Region schon 10.000 Kilometer mit dem E-Bike zurückgelegt hat.

Rentnerin Angelika Schlöter
Rentnerin Angelika Schlöter
Beim Blick auf die Erblasten des Ruhrgebiets drängt sich die Frage auf, was die großen Sünden von heute sind. „Das können Sie hier sehen“, sagt Michael Schwarze-Rodrian am Steuer seines Minivans. Der Verkehr auf der Autobahn A 40 beginnt gerade zu stocken, so wie fast jeden Tag. „Die Belastung, die wir durch Individualmobilität der Natur hinzufügen, ist riesig. Auf das können wir nicht stolz sein. Neben einer Energiewende steht im Ruhrgebiet auch eine Verkehrswende an. Es wurde schon viel Zeit vertrödelt.“
Langfristig gibt sich der Landschaftsplaner dennoch optimistisch. Er ortet einen weltweiten Trend zu mehr Umweltschutz, mehr Grün, mehr Nachhaltigkeit. Mit Blick auf den Klimawandel wird es „Ökosystemdienstleistungen“, wie sie die Forschung nennt, gerade in Städten dringend brauchen.

Digitale Aufbereitung: Oliver Geyer
Fotos: David Knes, Imago, Metropole Ruhr
Video: David Knes
Karte: Flourish/OpenStreetMap
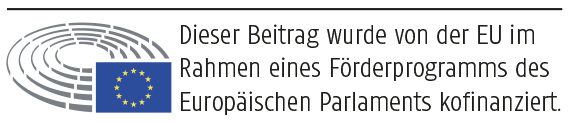
Videos: Die EU einfach erklärt
